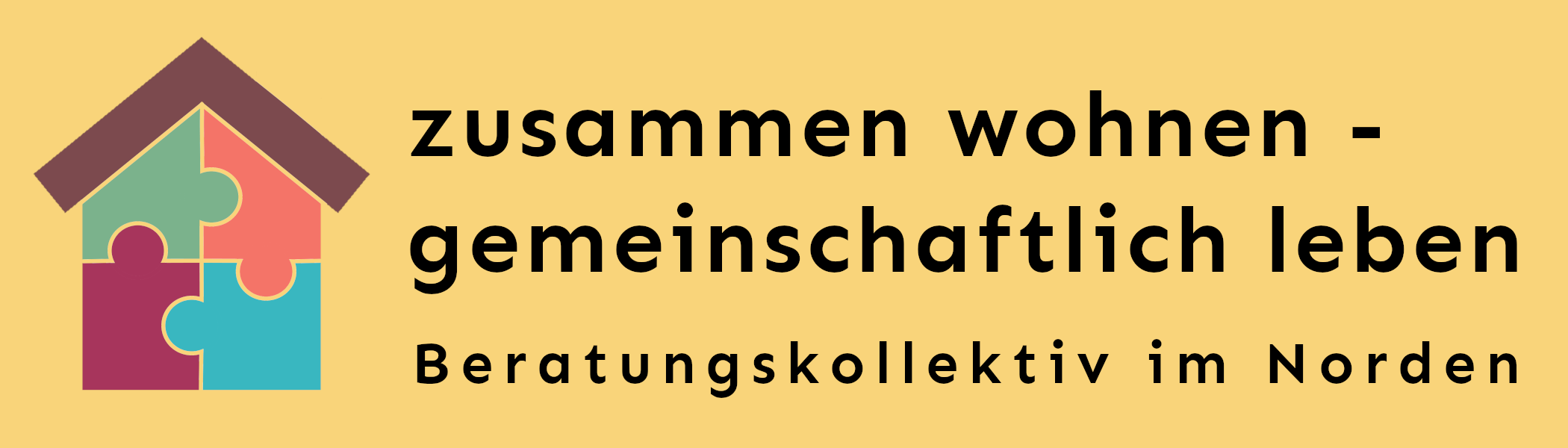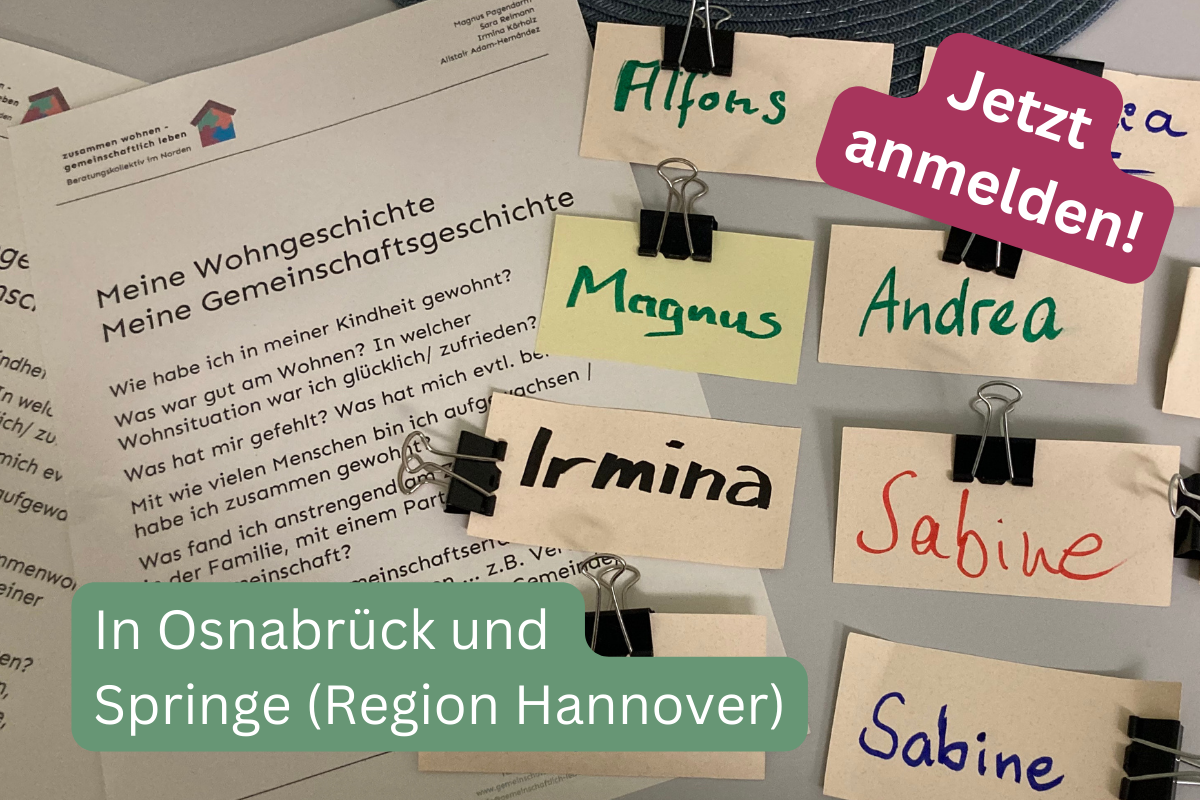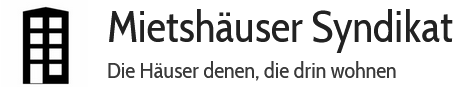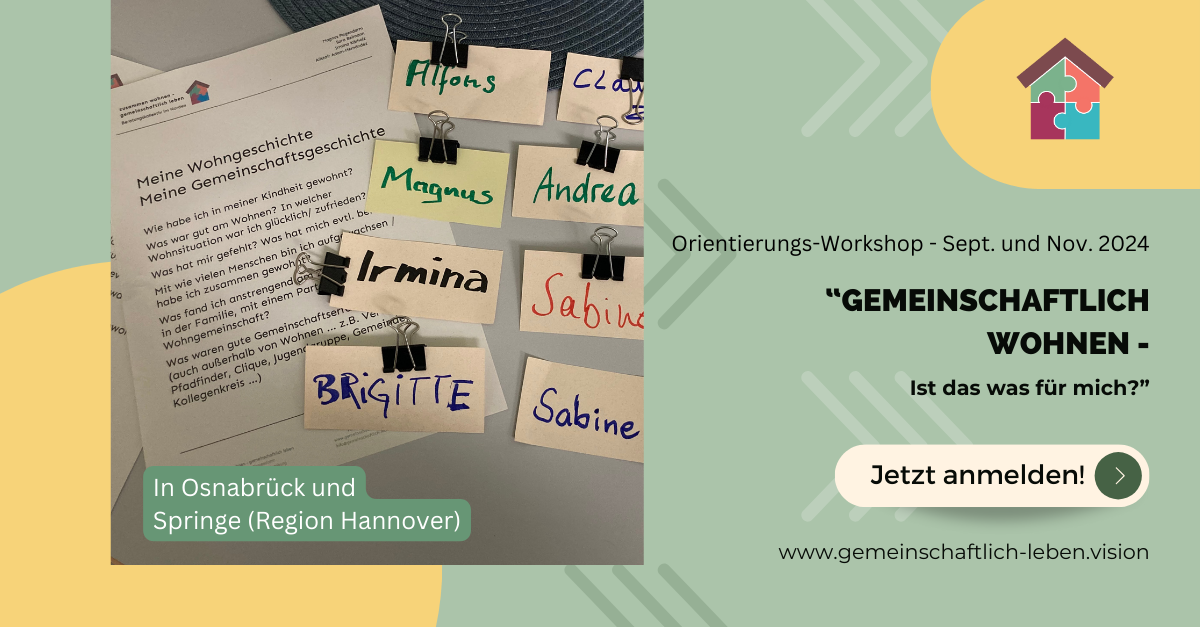Real Estate Arena 2024: Reflektionen zu „Neuen Wohnformen“
Eine erfolgreiche Allianz aus Verbänden der Architektur und Planung in Niedersachsen präsentierte sich am 5. und 6. Juni 2024 auf der Immobilienmesse „Real Estate Arena 2024“ in Hannover. Unser Beratungskollektiv „zwgl ‣ zusammen wohnen – gemeinschaftlich leben“ durfte dort zum Panel „Reflections: Neue Wohnformen“ einen Beitrag leisten – gemeinsam mit Vertreter:innen der Stadt Göttingen und der Gemeinde Loxstedt.